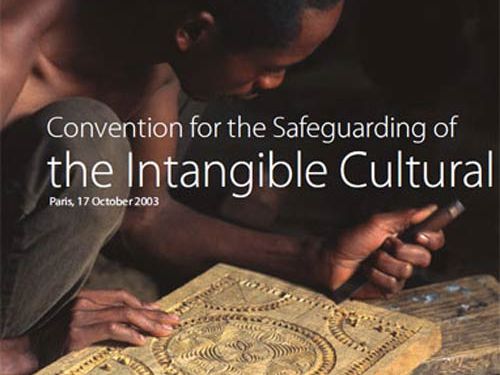Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich
Die Seitelpfeife, auch „Schwegel“ genannt, ist ein traditionelles Holzblasinstrument mit sechs Grifflöchern und wird vor allem im Alpenraum und speziell im Salzkammergut gespielt. Trotz ihrer einfachen Bauweise gibt es heute nur noch wenige Handwerker*innen, die die Seitelpfeife herstellen. Sie bleibt jedoch ein fester Bestandteil der Schützenmusik im Salzkammergut und spielt eine zentrale Rolle bei regionalen Bräuchen und Festen.
Das „Schifferlsetzen“ ist eine regional verwurzelte Tradition im Mariazellerland rund um den Nikolaustag. Dabei basteln Kinder in den Tagen vor dem Fest in Familienkreisen oder Bildungseinrichtungen kleine Papierschifferl, die sie bunt bemalen. Am „Krampustag“ werden diese Schifferl heimlich bei Verwandten und Bekannten „gesetzt“ und sind dann am Nikolaustag mit Süßigkeiten, Nüssen und anderen Kleinigkeiten gefüllt zur Abholung bereit. Auch heute hat diese Praxis eine identitätsstiftende und…
Mit dem Verkauf warmer Würstel durch die sogenannten „Bratlbrater“ wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Grundstein für die Wiener Würstelstandkultur gelegt. Die sich daraus entwickelnden freistehenden Würstelstände sind seither nicht nur für das Stadtbild, sondern auch als Ort der sozialen Zusammenkunft und den Sprachgebrauch in Wien prägend. Typisch für die Würstelstände sind neben dem freistehenden Stand das Sortiment, die ungezwungene Atmosphäre und der Wortschatz, der sich darum gebildet…
Die Neujahrs-Entschuldigungskarte (NJEK), eine künstlerisch gestaltete Druckgrafik, ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden und enthob Personen/Institutionen von den gesellschaftlich verpflichtenden Neujahrswünschen oder Neujahrsbesuchen. Der Erwerb dieser Karten wird mit Spenden für soziale Zwecke verbunden. Aktuell ist die NJEK der Region Hall in Tirol eine der letzten von ehemals über 50 Karten aus Ortschaften/Städten in ganz Österreich bzw. ehemaligen Gebieten der Habsburger-Monarchie.
Ursprünglich diente die Hufbeschlagskunst dem Überleben der Menschen durch die Nutzung von Pferden als Reit-, Zug- und Lastentiere. Heutzutage liegt der Fokus vor allem auf dem Einsatz von Pferden im Sport-, Kultur- und Freizeitbereich sowie in der tiergestützten Therapie. Hufschmied*innen spielen in all diesen Bereichen eine entscheidende Rolle für die Gesundheit der Pferde, indem sie eng mit Tierärzt*innen zusammenarbeiten— denn „ohne Hufe, keine Pferde!“ Die traditionelle Hufbeschlagskunst…
Der Pestkerzenumzug der Gemeinschaft der Kirchenbäuer*innen findet im Rahmen eines Fronleichnamsgottesdienstes am Herz-Jesu-Sonntag statt und wird als Feldmesse abgehalten. Dabei wird die Pestkerze geschmückt, aufgestellt und bei einer Prozession von einem Hochfeldaltar zum anderen mitgeführt. Die Tradition des Pestkerzenumzugs geht auf ein Versprechen der Bäuer*innen vor vielen Jahrhunderten zurück, eine überdimensionale Kerze als Dank für das Überleben der Pest zu spenden und einmal im Jahr…
Jährlich wird in Wolkersdorf bei der Fronleichnamsprozession die große Hauerfahne mitgetragen. Dabei tragen acht Personen aus dem Kreis der Wolkersdorfer Winzer*innen („Hauerburschen" und „Hauermädchen“) die Fahne, was als schwerste aber ehrenvollste Aufgabe angesehen wird. Dieselben „Hauerburschen“/„Hauermädchen“ sind auch mit dem Aufstellen und Umschneiden des Hüterbaumes in Wolkersdorf betraut. Das Aufstellen ist mit zahlreichen Aktivitäten, Kulinarik und musikalischer Begleitung verbunden.…
Holzschindeldächer sind besondere Blickfänger in der Landschaft. Die Arbeit des „Schindel kliabn‘s“ ist seit Generationen tradiert und wird von regionalen Almbauer*innen und Waldarbeiter*innen ausgeübt. Holzschindel sind ein weit verbreitetes altbewährtes Dachdeckungsmaterial mit einem äußerst geringen ökologischen Fußabdruck. Im Laufe der Jahrhunderte kaum verändert, wird das Handwerk an jüngere Generationen immer noch weitergegeben.
„Tarock-Königrufen“ ist ein Kartenspiel aus der Familie des Tarocks. Es wird österreichweit seit mehr als zwei Jahrhunderten gespielt und ist bis heute weit verbreitet. Das „Königrufen“ ist ein besonderes Kartenspiel, das mit der europäischen und der österreichischen Geschichte verbunden ist. Es besticht durch spielerischen und sprachlichen Variantenreichtum, Strategie und das Training der Merkfähigkeit. Die Spieler*innen nennen sich meist einfach Tarockierer*innen.
Das Montafoner Schäppele, ein aus silbernen und goldenen, gekräuselten Metallfäden und kleinen Metallblumen zusammengesetztes Krönchen oder etwa das Montafoner Mäßle sind Merkmale der Montafoner Tracht. Die typische Stoff- und Farbwahl, Motive, Herstellungsart sowie die verwendeten Materialien sind durch die Region bestimmt. Alle die Bekleidung zierenden Stickereien werden mit Seide und Baumwolle auf schwarzem Samt in Handarbeit ausgeführt, an denen geübte Sticker*innen ca. 500 Stunden arbeiten.…
Der Streuobstanbau, wie er heute praktiziert wird, entstand vor allem ab dem 17. Jahrhundert. Streuobstwiesen sind das Ergebnis einer landwirtschaftlich-kulturellen Entwicklung und eng mit menschlichem Wissen verbunden. In ganz Österreich wird der Streuobstanbau bis heute durch das Engagement von Obstbaumbesitzern, Mostereien, Direktvermarktern, Initiativen, Vereinen und Verbänden am Leben gehalten und weitergegeben.
„Loahmmandel“ oder auch „Loahmmandl“ sind Krippenfiguren, aus Ton entweder nach typischen regionalen Krippenfiguren selbst modelliert oder von vorgefertigten Modeln abgeformt und halbreliefmäßig gearbeitet, gebrannt und anschließend bemalt. Die Erstellung und Bemalung (Fassung) der Loahmmandel bildet in vielen Familien, Pfarrgemeinden und Vereinen einen gesellschaftlichen Höhepunkt im Jahreskreis, bei dem die regionalen und lokalen Besonderheiten von Generation zu Generation weitergegeben…
Seit dem Jahr 1498 haben verschiedene zünftische Bräuche unter den Zimmerer*innen in Windischgarsten bis heute Bestand. Am Jahrestag der Zimmererzunft, dem 19. März jeden Jahres, findet ein Messbesuch in der Pfarrkirche statt, gefolgt von einer Zusammenkunft in einem Gasthaus. Dort werden die zwei Zunftladen vom Zunftmeister und einem*r Stellvertreter*in geöffnet, die Anwesenden tragen sich in die Zunftbücher ein und entrichten das "Zunftgeld" für die Erhaltung der Zunftfahne und soziale Zwecke.…
Die Klang- und Spieltradition österreichischer Blasmusikkapellen entstand im 19. Jahrhundert aus den Regimentskapellen der k.u.k. Infanterieregimenter. Der typische Klang dieser Spielpraxis wird vor allem durch die Verwendung von weitmensurierten Blechblasinstrumenten wie Flügelhorn und Tenorhorn/Bariton geprägt, die einen weichen Klang erzeugen. Neben der charakteristischen Klanggestaltung zeichnen sich die Blasmusikkapellen auch durch ihr spezifisches Spielrepertoire, ihre Aufstellung, lokal…
Die Wandkonstruktionen im Alpenraum umfassen neben verschiedenen Formen des Steinmauerwerks Blockkonstruktionen aus Nadelholz. Für Viehställe, Almhütten und Holzstuben verwenden die Bäuer*innen und Holzknechte*mägde möglichst gerade, entrindete Rundstämme mit gleichen Durchmessern. Als Holzverbindungen werden an den Ecken Rundkerben mit Hilfe des Senklotes fugendicht ausgehackt, sodass in den Legern kein Wasser eindringen kann. Diese Handwerkstechnik wird von Bergbäuer*innen und…
Die Arbeit der Zuckerbäcker*innen ist immer noch zu einem großen Teil Handarbeit, die über Generationen tradiert ist und sowohl regionalen, betriebsspezifischen als auch transnationalen Charakter angenommen hat. Das Handwerk erfordert Präzision in der Ausführung sowie Kreativität und Anpassung in der Weiterentwicklung. Die Zutaten und die traditionelle Ver- und Bearbeitungsmethoden mittels verschiedenster Werkzeuge haben sich im Laufe der Jahrhunderte kaum verändert und dennoch Anpassung und…
Feuer, Luft, Wasser und Erde – beim Freihandschmieden wird mit den vier Elementen gearbeitet. Heute wie damals werden Schmiedeeisen und Stahl in glühendem Zustand durch Schlagen oder Drücken in freier Handarbeit bearbeitet. Durch unterschiedliche Schmiedeverfahren und unter Einsatz von Stöckel und Hämmer werden in jahrhundertalter Technik die Materialien geformt. Die daraus entstehenden geschmiedeten (Kunst-)Objekte reichen von herrschaftlichen Insignien bis hin zu Bauelementen.
Das Bestatten gehört zu den wesentlichen Elementen menschlicher Kultur und ist Bestandteil im Leben eines jeden Menschen. Die Bestatter*innen sind die aktiven Träger*innen der Bestattungs- und Friedhofskultur, die geprägt sind von lokalen und religiösen Ritualen, welche über die offiziellen Vorschreibungen hinausgehen. Dabei begleiten die Bestatter*innen Menschen bei ihrem letzten Abschied, unter Berücksichtigung der verschiedenen Ausdrucksformen des gemeinsamen Trauerns und Abschiednehmens…
Seit der Gründung von Theresienfeld 1763 spielt Bewässerung eine prägende Rolle im Leben der Ortsbevölkerung. Durch das künstlich angelegte Bewässerungssystem des "Tirolerbaches" werden bis heute, festen Regeln und Techniken folgend, Gärten und Hausäcker bewässert. Ende Oktober wird das Wasser "odraht", am ersten Aprilsonntag "kummts Wossa wieder". Die Wassergenossenschaft räumt, säubert und kontrolliert dabei die Anlage und überwacht die gerechte Wasserverteilung.
Die Salzschifffahrt auf der Traun prägte jahrhundertelang den Rhythmus und die Praktiken der Orte entlang des Flusses. Dazu gehörten auch das Rudern und Manövrieren der mächtigen, mehrere Tonnen schweren Salzzillen auf dem schnell fließenden Gewässer nauwärts (in Fließrichtung) zur Donau und der Schiffgegentriebes (die Rückführung gegen den Strom) der Zillen mit Hilfe von schweren Norikerpferden. Trotz Verschwinden der Salzindustrie wird bis heute die Praxis der Naufahrt und des…
Das Krippenbauen und Krippenschauen ist eine Tradition in Wenns, die seit mehr als 150 Jahren mit der Ortschaft verbunden ist. Von der "Wenner Kastenschneekrippe" über die "Wenner Kastenspiegelkrippe" bis hin zum "Wenner Mooskrippenberg" – die Instandhaltung, Weiterentwicklung und Aufstellung erfolgt durch die "Wenner Krippeler". Die neu gebauten Krippen werden in Privathäusern und im öffentlichen Bereich aufgestellt und den Besucher*innen beim "Krippenschauen von Haus zu Haus" präsentiert.
Die Zunft der Fleischhauer in Gars am Kamp besteht seit 1535. Trotz formeller Aufhebung der Zünfte werden Praktiken wie Zunfttag, die Ehrenkranz- und Ehrensiegelverleihungen, die Verleihung des Goldenen Ehrenrings und die Fronleichnamsprozession mit dem Vorantragen der Zunftfahne nach wie vor ausgeübt. Diese Praktiken sowie das bis heute weitergetragene Wissen um das Handwerk haben für die Mitglieder und ihr Umfeld nach wie vor eine wichtige soziale, ökonomische und ökologische Bedeutung.
Von "Köllamaunn" über die "Köllastund" und die "Köllapartie" bis hin zur "Köllajausn" – die Weinviertler Kellergassen stellen einen Lebens- und Arbeitsraum für die lokale Bevölkerung dar. Mit der Weinviertler Kellerkultur hat sich eine spezielle Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens entwickelt. Wesentlich dabei ist das Zusammenkommen von Menschen in Presshäusern und Kellern, wobei diese Interaktion weiterhin von jahrhundertealten Regeln geprägt ist.
Seit mehr als 60 Jahren findet am 15. August die jährliche Wallfahrt der Goldhauben- und Trachtengruppen des Mostviertels statt. Höhepunkt dabei ist der feierliche Einzug aller rund 1.000 Wallfahrer*innen in die Kirche mit anschließendem Festgottesdienst und Segnung der mitgebrachten Kräuter und der Wallfahrkerze. Jedes Jahr findet das Ereignis in einer anderen Gemeinde bzw. einer der 54 Wallfahrtsorte im Mostviertel statt und ist dabei sowohl ein spirituelles als auch soziales Ereignis.
Der Fasnachtsbrauch der Patscher Schellenschlagerinnen findet jährlich am Unsinnigen Donnerstag statt. Dabei "läuten", die nach Größe in Zweierreihe aufgestellten und maskierten Schellenschlagerinnen, die Glocken bzw. Schellen im vorgegebenen Rhythmus der Hexe. Zwar ist das Schellenschlagen auch in anderen Orten zu beobachten, doch sind im Gegensatz zu vielen anderen Fasnachten in Tirol, die Ausübenden ausschließlich Frauen.