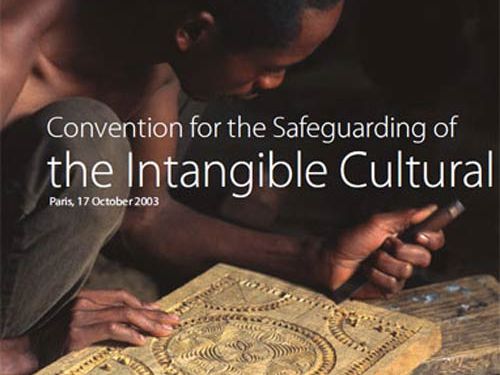Warum ist Immaterielles Kulturerbe nicht Welt(kultur)erbe?
Die UNESCO setzt sich weltweit für den Schutz und die Erhaltung kulturellen Erbes ein. Unterschiedliche Programme und völkerrechtliche Instrumente sollen Staaten und Gemeinschaften ermutigen, unterstützen und verpflichten, das kulturelle Erbe in seinen vielfältigen Erscheinungsformen sichtbar zu machen und seine Bewahrung bzw. Erhaltung und Weitergabe zu fördern. Im Kontext der UNESCO haben sich in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere zwei Begrifflichkeiten etabliert, zwischen denen aufgrund ihrer jeweiligen Merkmale unterschieden wird: Welterbe und Immaterielles Kulturerbe.
In der Öffentlichkeit wird insbesondere der Begriff Welterbe bzw. Weltkulturerbe häufig als Synonym für kulturelles Erbe, dessen besonderer Wert von der UNESCO anerkannt wird, verwendet. Oft findet er auch – fälschlicherweise – im Zusammenhang mit dem Immateriellen Kulturerbe Verwendung, das in den vergangenen Jahren verstärkt Aufmerksamkeit erfährt. Worin liegt nun der Unterschied zwischen Welterbe und Immateriellem Kulturerbe und wie ergänzen sich diese beiden Konzepte?
Welterbe – universeller Wert für die Menschheit
Das UNESCO-Welterbe basiert auf der „UNESCO-Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ (1972). Es umfasst herausragende (physische) Orte, Denkmale, Landschaften und Stätten, die von außergewöhnlichem universellen Wert für die Menschheit sind. Dazu gehören beispielsweise: ✔Historische Baudenkmäler & Stadtensembles (z. B. die Altstadt von Prag) ✔ Kulturlandschaften (z. B. das Loire-Tal) ✔ Industriedenkmäler & Kunstwerke (z. B. prähistorische Felszeichnungen) ✔ Naturgebiete und Ökosysteme von außergewöhnlicher Bedeutung (z. B. der Serengeti Nationalpark). Das Hauptziel der Konvention ist es, diese einzigartigen Orte vor Bedrohungen wie Verfall, Zerstörung oder unkontrollierter Entwicklung zu schützen und ihre Erhaltung durch nationale und internationale Anstrengungen sicherzustellen.
Weltweit zählen weit über 1200 solcher Stätten zum UNESCO-Welterbe gelistet. In Österreich befinden sich derzeit 12, unter anderem: ✔ Historisches Zentrum von Wien (2001) ✔ Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut (1997) ✔ Alte Buchenwälder und Buchenurwälder (2007, Erweiterungen 2011 & 2017), u. v. m.
Wer entschied darüber, was Welterbe wird?
Das Ansuchen um Aufnahme einer Stätte in die Welterbeliste erfolgt durch den Vertragsstaat – im Falle Österreichs durch die Republik, vertreten durch die/den jeweiligen Kulturminister*in. Die Nominierung einer Welterbestätte ist ein umfangreiches Unterfangen, im Rahmen dessen eine Reihe von Unterlagen, Plänen usw. auf Basis aktueller Forschung bereitgestellt werden müssen. Nach der Einreichung wird das Nominierungsdossier von internationalen Expert*innen evaluiert. Über die endgültige Aufnahme in die Welterbeliste entscheidet schließlich das Welterbekomitee (World Heritage Committee). Dieses tagt einmal jährlich und besteht aus 21 gewählten Staaten bzw. deren Vertreter*innen. Mehr Informationen zum Welterbe hier: https://www.unesco.at/kultur/welterbe.



Immaterielles Kulturerbe – lebendige Praktiken erhalten
Die „UNESCO-Konvention zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes“ wurde 2003 verabschiedet und rückt gelebte Traditionen, Handwerkskünste und kulturelle Ausdrucksformen in den Fokus. Ziel der Konvention ist es, lebendiges Erbe, das von Menschen getragen und ausgeübt wird, als wichtiges Kulturgut sichtbar zu machen. Die Ausübenden sollen dabei in der Erhaltung, Entwicklung und kreativen Weitergabe ihres lebendigen Erbes unterstützt werden. Immaterielles Kulturerbe umfasst: ✔ Mündlich überlieferte Traditionen & Sprachen ✔ Darstellende Künste (Tanz, Theater, Musik) ✔ Gesellschaftliche Praktiken, Rituale & Feste ✔ Wissen & Praktiken zur Natur und zum Universum ✔ Traditionelle Handwerkstechniken. Darunter fallen zum Beispiel die Fasnacht in Imst, der Handblaudruck, die Lieder der Lovara, das Wissen der Bestatter*innen oder der Aberseer Schleuniger. Immaterielles Kulturerbe ist nicht statisch und hat seine Bedeutung vor allem im Wert, den ihm seine Ausübenden zuschreiben.
Wer entschied darüber, was Immaterielles Kulturerbe wird?
Immaterielles Kulturerbe wird sowohl in nationalen Verzeichnissen als auch auf internationalen Listen erfasst. Auf nationaler Ebene werden auf Beschluss des „Fachbeirates für das Immaterielle Kulturerbe“ Elemente in das „Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich“ aufgenommen. Sie sind damit Immaterielles Kulturerbe in Österreich. Derzeit gibt es mehr als 170 Eintragungen. Daneben werden auch auf internationalen Listen Formen des Immateriellen Kulturerbes sichtbar gemacht. Weltweit gibt es derzeit über 700 Eintragungen, 14 davon sind auch für Österreich eingetragen. Ein internationales Expert*innenkomitee sowie das Zwischenstaatliche Komitee der Konvention geben Empfehlungen und treffen Entscheidungen dazu. Mehr dazu unter: unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe



Fazit
Die beiden Konventionen befassen sich als völkerrechtliche Instrumente mit dem Erhalt des kulturellen Erbes, jedoch mit unterschiedlichen Aspekten, Zielen und rechtlichen Mechanismen, die ihnen zugrunde liegen. Die Verwendung eines Sammelbegriffs wie „Welt(kultur)erbe“ oder gar „Immaterielles Welterbe“ stiftet nicht nur Verwirrung, sondern überdeckt auch die unterschiedlichen rechtlichen Wirkweisen dieser Instrumente sowie die Unterschiede in den jeweiligen Anforderungen an die Weitergabe an zukünftige Generationen.
Ein Beispiel: Während „Schutz“ im Welterbe-Kontext meist die physische Bewahrung im Sinne des Denkmal- oder Naturschutzes bedeutet, steht beim Immateriellen Kulturerbe die „Erhaltung“ im Fokus; also eine kreative, lebendige Weitergabe, da lebendiges Erbe per Definition von Wandel geprägt ist. Doch auch Welterbe ist nicht völlig statisch: Sein Schutz erfolgt stets in einem sich verändernden gesellschaftlichen und natürlichen Umfeld. Restaurierungen, neue Nutzungsformen oder Klimawandelanpassungen zeigen, dass auch das materielle Kulturerbe bzw. Welterbe einem behutsamen Wandel unterliegt. Allerdings ist besonders beim Immateriellen Kulturerbe eine stete dynamische Weitergabe und kreative Neugestaltung wichtig, um für seine Ausübenden fortwährend von Bedeutung zu bleiben. Dem Welterbe hingegen wird eine überzeitliche Relevanz für die gesamte Menschheit zugeschrieben.
Nicht zuletzt darum ist eine präzise begriffliche Unterscheidung notwendig. Nur so lassen sich die unterschiedlichen Formen des kulturellen Erbes in ihren Eigenheiten wertschätzen und ihre jeweiligen Erhaltungsstrategien besser definieren.
Immaterielles Kulturerbe & Welterbe – gesamtheitlich denken
Wenngleich es sinnvoll und oft auch notwendig ist, im Zusammenhang mit der UNESCO und ihren internationalen Übereinkommen begrifflich zwischen Welterbe und Immateriellem Kulturerbe zu unterscheiden, sind diese beiden Aspekte unweigerlich eng miteinander verbunden. Sie spiegeln in ihrem Zusammenspiel nicht nur die Vielfalt des kulturellen Erbes wider, sondern bereichern und bedingen sich auch: Materielle Stätten erhalten durch die damit verbundenen lebendigen Traditionen und Praktiken oftmals ihre tiefere Bedeutung und kulturelle Relevanz, während umgekehrt Immaterielles Kulturerbe vielfach an spezifische Orte gebunden ist, um die sich Praktiken entwickelt haben bzw. an denen sie stattfinden. Überliefertes Wissen und kulturelle Praktiken, die als Immaterielles Kulturerbe weitergegeben werden, sind oft auch wesentlich für den physischen Erhalt von Welterbe-Stätten und anderen Orten des physischen Kulturerbes: etwa traditionelle Bauformen, Handwerkskunst oder landwirtschaftliche Techniken. Dieses enge Ineinandergreifen dieser beiden Bereiche wird auch von der UNESCO, trotz der oft notwendigen Trennung, anerkannt und gefördert. Immer öfter werden die Synergien der beiden Kategorien hervorgehoben und zur Geltung gebracht.
Neben der UNESCO, die unter anderem im Rahmen der globalen Kulturkonferenz „MONDIACULT“ und der Deklaration „The Spirit of Naples“ der “Naples Conference” das Zusammenwirken betont, unterstreichen auch die Faro-Konvention des Europarates oder ICOMOS (Internationale Rat für Denkmalpflege) die wichtigen Synergien und Wechselbeziehungen Materiellen und Immateriellen Kulturerbes. Im November 2024 beispielsweise verabschiedete ICOMOS die „International Charter and Guidance on Sites with Intangible Cultural Heritage“ (Internationale Charta und Leitlinien für Stätten mit Immateriellem Kulturerbe), die auf die Notwendigkeit verweist, kulturelles Erbe in all seinen Aspekten und Ausformungen gesamtheitlich zu betrachten, um ein umfassendes Verständnis und eine effektive Erhaltung zu gewährleisten. Sie hebt hervor, dass traditionelle, soziale und kulturelle Praktiken sowie das über Generationen weitergegebene Wissen den physischen Objekten und Stätten Bedeutung, Wert und Kontext verleihen. Durch die Anerkennung und den Schutz dieser Wechselbeziehungen können sowohl die physischen Strukturen als auch die damit verbundenen lebendigen Praktiken für zukünftige Generationen erhalten werden.

Beispiele in Österreich:
-
Trockensteinmauern & Kulturlandschaft Wachau : Ein eindrucksvolles Beispiel für diese Synergien ist die Kulturlandschaft Wachau, Teil des UNESCO-Welterbes und das Trockensteinmauern, das sich als Kulturpraktik seit 2024 auf der Repräsentativen Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit befindet. Die Trockensteinmauern sind nicht nur charakteristisch für die Landschaft der Wachau und Grundlage für den Weinbau, sondern auch essenziell für die Stabilität der Weinterrassen, den Erosionsschutz und die Biodiversität dieser Region. Die seit Generationen hinweg weitergegebene Technik des Trockensteinmauerns bildet die notwendige Grundlage, dieses wesentliche Merkmal dieser Kulturlandschaft zu erhalten und bildet damit selbst einen bedeutenden Teil dieses kulturellen Erbes.

-
Dombauhüttenwesen & Wien: Der Stephansdom, als eines der bedeutendsten Baudenkmäler der Stadt, bildet einen integralen Bestandteil und wesentliches Element der Welterbestätte Historisches Zentrum von Wien. Gleichzeitig sorgt das Dombauhüttenwesen in Österreich (St. Stephan und Mariendom Linz), seit 2018 Immaterielles Kulturerbe in Österreich und seit 2020 zusammen mit weiteren Ländern als internationales gutes UNESCO-Praxisbeispiel ausgezeichnet, für die kontinuierliche Pflege und Restaurierung dieses Meisterwerks der Gotik. Die Steinmetzkunst und das traditionelle Wissen um Bau- und Restaurierungstechniken sichern die Langlebigkeit historischer Bauwerke und verbinden Geschichte mit gelebter Handwerkskunst.
Diese Beispiele zeigen: Materielles und Immaterielles Kulturerbe sind zwar in ihren Definitionen und rechtlichen Aspekten unterscheidbar, in der gelebten Praxis und vor allem im Erhalt jedoch nicht immer strikt voneinander trennbar. Insbesondere diese Verflechtungen zeigen die Vielfalt und die Wechselwirkungen kulturellen Erbes.
Infoblatt: Unterschied Immaterielles Kulturerbe und Welterbe
- Immaterielles_Kulturerbe_Welterbe.pdf 229 KB (pdf)