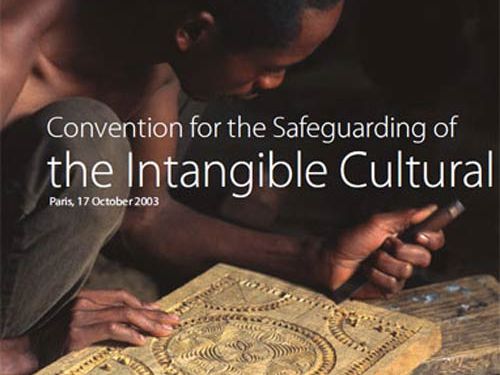„Unter "immateriellem Kulturerbe" sind Praktiken, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten – sowie die dazu gehörigen Instrumente, Objekte, Artefakte und kulturellen Räume – zu verstehen, die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen.“ - UNESCO Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes.
Die UNESCO hat fünf Bereiche definiert, die immaterielles Kulturerbe beinhalten:
- Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache als Trägerin des immateriellen Kulturerbes
- Darstellende Künste
- Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste
- Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum
- Traditionelle Handwerkstechniken
Unter Tradition/kulturelle Praktik wird oft fälschlicherweise eine Bewahrung und Konservierung althergebrachter, überlieferter Werte verstanden, die keiner Veränderung ausgesetzt sein dürfen. Tatsächlich aber ist das Immaterielle Kulturerbe dynamisch und durch Veränderung gekennzeichnet. Als Faustregel gilt, dass eine Tradition/kulturelle Praktik über mindestens drei Generationen hinweg weitergegeben wurde. Dabei ist es auch möglich, dass sich Funktion, Form oder Inhalt verändern. Der kreative Prozess der Überlieferung ist geradezu ein Merkmal lebendiger Traditionen.
Immaterielles Kulturerbe betrifft alle Menschen. Jede*r kennt – bewusst oder unbewusst - Bräuche, Traditionen, Handwerkstechniken oder überliefertes Wissen, die für eine bestimmte Region oder eine Gemeinschaft identitätsstiftenden Charakter besitzen. Oft sind wir von Immateriellem Kulturerbe umgeben, ohne es explizit als solches zu bezeichnen. Die öffentliche Wahrnehmung von lebendigen Traditionen als Immaterielles Kulturerbe durch die Unterstützung der UNESCO kann dabei helfen, Bewusstsein für solche kulturellen Phänomene zu schaffen und respektvollen Umgang mit diesen zu gewährleisten.
Das primäre Ziel des Nationalen Verzeichnisses ist eine Bestandsaufnahme sowie die Sichtbarmachung des Immateriellen Kulturerbes eines Landes. Es handelt sich dabei aber um keine Erfassung des "österreichischen Erbes", sondern um eine Inventarisierung von immateriellem Kulturerbe in Österreich. Die in das Verzeichnis aufgenommenen Elemente und ihre Träger*innen stehen exemplarisch für die Kreativität und den Erfindergeist unserer Gesellschaft.
Für eine Eintragung in das Nationale Verzeichnis kommen jene Elemente in Frage, die für die jeweilige Gemeinschaft tatsächlich von Relevanz sind und von den betroffenen Menschen auch heute noch praktiziert werden. Eine Konservierung von Elementen, die nicht mehr gelebt bzw. aktiv vermittelt werden, ist nicht im Sinne des Übereinkommens.
Jede Gemeinschaft, aber auch jede Einzelperson, die selbst Bräuche, Traditionen, Wissen und Können pflegt, kann die Aufnahme eines von ihr vorgeschlagenen Elements in das Nationale Verzeichnis mittels Bewerbung bei der Österreichischen UNESCO-Kommission beantragen. Wichtig dabei ist, dass alle betroffenen Gemeinschaften und Personen mit der Antragstellung einverstanden sind und dies mit der Unterzeichnung einer Einverständniserklärung bestätigen.
Elemente müssen generell einer Reihe von Kriterien entsprechen, um als Immaterielles Kulturerbe gelistet zu werden. Diese sind von der Konvention vorgegeben, aber auch mit ehtischen Vorstellungen und Werten der UNESCO in Einklag stehen. Folgende Beispiele gelten u.a. nicht als Immaterielles Kulturerbe da sie nicht diesem Sinne entsprechen und werden deshalb nicht aufgenommen:
- Vereine oder Produkte, denn eine Institution oder ein Produkt per se können nicht Immaterielles Kulturerbe sein.
- Prakitken, die das Töten von Tieren beinhalten.
- Praktiken die nicht gesetzteskonform sind mit der Rechtslage in Österreich.
- Profesionelle Sportarten.
Der Begriff „Weltkulturerbe“ ist dem materiellen Erbe vorbehalten. In Analogie zu den internationalen Welterbelisten gibt es aber drei UNESCO-Verzeichnisse für das Immaterielle Kulturerbe:
- die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
- die Liste für dringend erhaltungsbedürftiges immaterielles Kulturerbe und die
- das Verzeichnis guter Praxisbeispiele
Nähere Informationen zu den internationalen Listen finden Sie hier. Eine Bewerbung für die internationalen Listen ist nur für jene Elemente möglich, die bereits in einem nationalen Verzeichnis gelistet sind.
Das Immaterielle Kulturerbe rückt den Menschen und seine kulturellen Traditionen in den Mittelpunkt. Für den Erhalt Immateriellen Kulturerbes ist es wichtig, dass ein Element von den jeweiligen Träger*innen als wertvoll angesehen wird, denn nur sie können für eine zeitgemäße Vermittlung und damit für seine Erhaltung sorgen. Die UNESCO sowie ihre nationalen Kommissionen können diese Bemühungen durch Sichtbarmachen und bewusstseinsfördernde Maßnahmen unterstützen.
Der Fachbeirat Immaterielles Kulturerbe entscheidet 1-2x jährlich über die Aufnahme von Elementen in das Nationale Verzeichnis. Dieses Gremium setzt sich aus Vertreter*innen der involvierten Bundesministerien, der Bundesländer sowie Expert*innen zu den fünf Bereichen des immateriellen Kulturerbes zusammen.
Als lebendiges Erbe im Sinne der UNESCO ist das Immaterielle Kulturerbe kein statisches Relikt der Vergangenheit. Die Aufnahme in das nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes bedeutet keine Musealisierung eines Brauchs oder einer Tradition, sondern vielmehr die Anerkennung einer Praxis, die in stetigem Austausch mit ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt steht. Praktiken können sich deshalb auch ändern. Deshalb fragt nach der Aufnahme die Österreichische UNESCO-Kommission alle ca. 5 Jahre nach dem Statuts der Eintragungen bzw. werden zu allen Neuerungen informiert.
Aufgenommene Elemente haben zudem Anspruch auf die Verwendung des Logos für das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes.
Nein. Die Aufnahme in das Nationale Verzeichnis ist ausdrücklich nicht mit Ansprüchen auf spezielle Fördermittel oder mit rechtlichen Konsequenzen verknüpft.
In Einzelfällen können Elemente auch wieder aus dem Nationalen Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbe entfernt werden. Dies kann unter anderm sein, wenn ein Element aufgehört wird zu praktizieren, oder es nicht mehr den Prinzipien des Immateriellen Kulturerbes entspricht. Die Entscheidung dazu wird vom Fachbeirat Immaterielles Kulturerbe getroffen.
Monitoring ist eine laufende Beobachtung der Elemente. Eintragungen in das Verzeichnis sind Momentaufnahmen in der Existenz und Entwicklung einer Praxis. Im Zuge dieser Entwicklung werden auch bewährte Traditionen hinterfragt. Dabei ergibt sich in den Aushandlungsprozessen immer wieder die Frage, ob bestimmte Elemente einer Praxis weiterhin notwendig und/oder zeitgemäß sind. In seltenen Fällen werfen Praktiken aber auch die Frage auf, ob sie in dieser Form den Prinzipien der UNESCO entsprechen. Beispiele sind unter "Monitoring & Dialog" auf folgender Seite zu finden: Monitoring & Dialog
- Was ist Immaterielles Kulturerbe 197 KB (pdf)