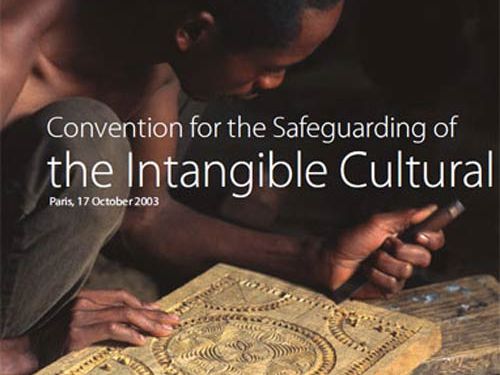Dynamisches Erbe
Das immaterielle Kulturerbe ist einem kontinuierlichen Wandel unterworfen. Es entwickelt sich durch dynamische Aushandlungsprozesse zwischen Individuen, Interessensgruppen und gesellschaftlichen Akteur*innen. Diese Verhandlungen finden auf verschiedenen Ebenen statt – teils im Hintergrund, teils in der öffentlichen Debatte – und verlaufen fortlaufend oder in wiederkehrenden Zyklen. Als lebendiges Erbe im Sinne der UNESCO ist das immaterielle Kulturerbe kein statisches Relikt der Vergangenheit. Die Aufnahme in das nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes bedeutet keine Musealisierung eines Brauchs oder einer Tradition, sondern vielmehr die Anerkennung einer Praxis, die in stetigem Austausch mit ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt steht. Im Zuge dieser Entwicklung werden auch bewährte Traditionen hinterfragt. Dabei ergibt sich in den Aushandlungsprozessen immer wieder die Frage, ob bestimmte Elemente einer Praxis weiterhin notwendig und/oder zeitgemäß sind. In seltenen Fällen werfen Praktiken aber auch die Frage auf, ob sie in dieser Form den Prinzipien der UNESCO entsprechen.
Aktueller Dialog:
Der Funkensonntag in Vorarlberg
Ein aktuelles Beispiel für diese Diskurse stellt das kulturelle Element des „Funkensonntags“ dar. In den Gemeinden Vorarlbergs wird am Sonntag nach Aschermittwoch traditionell ein Funkenfeuer entzündet, um den Abschluss der Alten Fasnacht zu markieren. Die Vorbereitungen beginnen bereits am Faschingsdienstag mit dem Schlagen der Funkentanne, die eine Höhe von bis zu 30 Metern erreichen kann. Am Samstag vor dem Funkensonntag wird das Funkenfeuer errichtet, indem gesammelte Materialien zu einem turmartigen Gebilde aufgeschichtet werden. Ein zentraler Bestandteil des Brauchs ist das Verbrennen einer Strohpuppe, der sogenannten „Funkenhexe“, die symbolisch das Ende der Fasnacht darstellt.
Die Darstellung der „Funkenhexe“ weist stereotype weibliche Merkmale auf und steht daher immer wieder im Zentrum von Diskriminierungsdebatten. Kritische Stimmen betonen, dass die Verbrennung dieser Figur problematische Geschlechterbilder transportiert. In Reaktion darauf haben einige Funkenzünfte begonnen, geschlechtsneutrale Stoffpuppen zu verwenden, die keine expliziten weiblichen Merkmale aufweisen. Allerdings handelt es sich hierbei um Einzelfälle – die Mehrheit der Gemeinschaften rund um den Funkensonntag hält an der traditionellen Darstellung der Puppe fest.
Die gesellschaftliche Debatte um die „Funkenhexe“ hält bereits seit längerer Zeit an. In diesem Kontext wurde der Österreichischen UNESCO-Kommission 2024 eine Petition aus Vorarlberg vorgelegt, mit der Forderung, den Kulturerbe-Status des Funkensonntags zu überprüfen. Der sogenannte „Antrag auf Überprüfung des UNESCO-Kulturerbe-Status des Funkensonntags“ (siehe Dokument im Downloadbereich) war Anlass, sich vertiefend mit diesem Element auseinanderzusetzen und einen offenen Dialog zu den vorhandenen Kontroversen rund um das Element zu begleiten.
Auf Grundlage der Expertise des Fachbeirats für Immaterielles Kulturerbe, der Stellungnahmen der ursprünglichen Antragsteller*innen sowie weiterer Fachleute und Praktizierender werden nun weitere Schritte gesetzt. Dabei wird thematisiert, inwiefern der Funkensonntag im Einklang mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen sowie den Grundsätzen der UNESCO steht. Der Prozess zielt darauf ab, eine fundierte Abwägung zwischen kultureller Tradition und zeitgemäßen Wertvorstellungen zu ermöglichen.
Link zum Websiteeintrag "Funkensonntag"
Dokumente
- Adressiert an den Fachbeirat Immaterielles Kulturerbe: Antrag auf Überprüfung des UNESCO-Kulturerbe-Status des Funkensonntags; 16. März 2024 140 KB (pdf)
- Antwortschreiben des Fachbeirats Immaterielles Kulturerbe auf den Antrag zur Überprüfung; 15. Juni 2024 98 KB (pdf)
- Stellungnahme Praktizierende: Verband der Vorarlberger Fasnatzünfte- und -Gilden 127 KB (pdf)
- Stellungnahme Stadtmuseum Dornbirn 99 KB (pdf)
- Stellungnahme: Matthias Beitl, Volkskundemuseum Wien 21 KB (pdf)