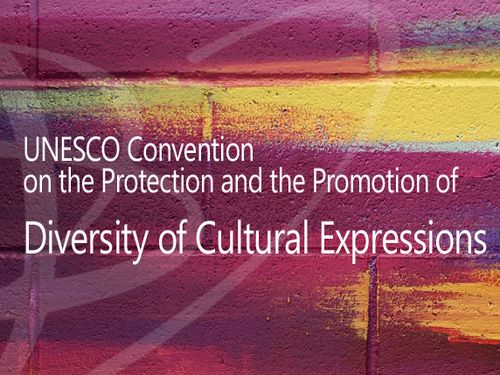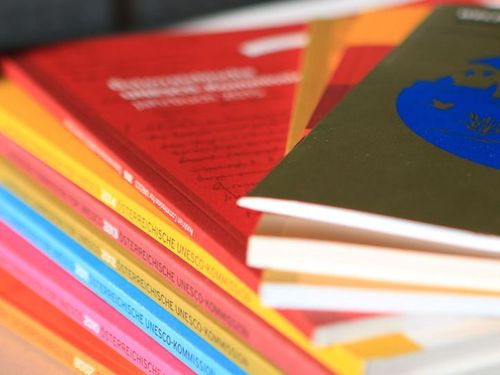TTIP: Gefahr für die österreichische Kunst & Kultur?
Während das Chlorhühnchen in aller Munde ist, beschäftigt sich hierzulande kaum jemand mit den möglichen Auswirkungen des geplanten Freihandhandelsabkommens mit den USA auf den Kulturbereich. Dabei könnte TTIP schwerwiegende Folgen für die österreichische Kultur haben. Von der österreichischen Kulturförderung über die Buchpreisbindung bis zu den Theatern, Orchestern und Museen – alles stehe bei TTIP zur Disposition, warnen KritikerInnen. Gesicherte Informationen liegen jedoch kaum vor. Eine Spurensuche nach Fakten…
Artikel von Y. Gimpel, erstmals erschienen in gift. zeitschrift für freies theater, 02/2015
1. Was ist TTIP?
TTIP (Transatlantic Trade and Investement Partnership) ist das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. Seit Juli 2013 wird verhandelt, bis Ende 2015 soll das finale Abkommen auf dem Tisch liegen. Ziel von TTIP ist, den Handel zwischen der EU und den USA durch den Abbau von Handels- und Investitionshemmnissen zu erleichtern und damit zum Wirtschaftswachstum beizutragen.
2. Wer verhandelt TTIP?
Das TTIP-Abkommen wird zwischen MitarbeiterInnen der Europäischen Kommission unter der Leitung der Generaldirektion Handel und der US-Administration verhandelt.
3. Was ist Grundlage der Verhandlungen?
Die Europäische Kommission verhandelt im Namen der 28 EU-Mitgliedstaaten auf Basis eines Verhandlungsmandats. Dieses Mandat wurde im Juni 2013 von den europäischen Staats- und Regierungschefs einstimmig verabschiedet. Es definiert Umfang, Ziele und Leitlinien für die TTIP-Verhandlungen durch die Europäische Kommission.
4. Was ist besonders an TTIP?
Wie der Name schon sagt, soll TTIP über klassische Freihandelsabkommen hinausgehen und eine möglichst umfassende Partnerschaft begründen. Neben dem Abbau klassischer Handelshemmnisse wie Zöllen und Regelungen, die den Marktzugang für Waren und Dienstleistungen beschränken, wird mit TTIP auch größere regulatorische Komptabilität zwischen der EU und den USA angestrebt.
Gemeint ist damit etwa die Harmonisierung bzw. gegenseitige Anerkennung von unterschiedlichen Standards und Regelungen – etwa bei Produktkennzeichnungen, Zulassungsverfahren und Auflagen – sowie die zukünftige Abstimmung vor Einführung neuer Regeln. KritikerInnen befürchten, dass TTIP damit auch Standards des KonsumentInnen- und ArbeitnehmerInnenschutzes, des Lebensmittel- und Umweltschutzes sowie der öffentlichen Daseinsvorsorge – von Wasser, über Gesundheit bis zur kulturellen Infrastruktur – zur Diskussion stellt.
5. Was hat das mit Kultur zu tun?
Auch im Kunst-, Kultur- und Medienbereich gibt es zahlreiche Hemmnisse, die den freien Handel beschränken. Im Prinzip ist jede Regelung oder Förderung, die nationales Kulturschaffen bzw. inländische KünstlerInnen begünstigt, ein Eingriff in den freien Wettbewerb und damit als Handelshemmnis zu werten. Überspitzt ausgedrückt: steht eine Kunst- oder Kulturförderung nicht weltweit allen, die Gleichartiges anbieten, offen, handelt es sich um einen wettbewerbsverzerrenden Eingriff in den Markt. Dementsprechend sind sämtliche Kultursektoren vom Handelsrecht erfasst, unabhängig davon, ob es sich um Güter (z.B. Bücher, Bilder, CDs, ...) oder Dienstleistungen (z.B. Theateraufführungen, Musikschulwesen, TV-Sendungen, ...) handelt.
Die Palette an „wettbewerbsverzerrenden“ kulturpolitischen Instrumenten reicht jedoch weit über die direkte Förderung hinaus: von der öffentlich-rechtlichen Organisation von Kultureinrichtungen wie Museen und Theatern, über die Finanzierung kultureller Angebote durch Gebühren, wie etwa Bibliotheken und Rundfunk, bis zu besonderen Steuerregelungen und Preisregulierungen für Kulturprodukte. Alle diese Steuerungsinstrumente verzerren den freien Wettbewerb. Sie sind Handelsbarrieren und als solche potentiell Gegenstand der Verhandlungen zwischen der EU und den USA.
6. Steht Kunst und Kultur bei TTIP zur Diskussion?
Ja. Die Annahme, der Kulturbereich sei von den TTIP-Verhandlungen ausgeschlossen, ist ein Missverständnis. Das Verhandlungsmandat sieht keine Ausnahme für den Kulturbereich vor. Lediglich für audiovisuelle Dienstleistungen (Film, TV und Radio) wurde eine Teilausnahme im Verhandlungsmandat definiert. Über alle anderen Bereiche darf die Europäische Kommission verhandeln. Dies entspricht auch dem dezidierten Wunsch der Kommission, keinen Bereich a priori aus den Verhandlungen auszuklammern.
7. Warum wollen Kulturschaffende den Kulturbereich vor TTIP schützen?
Entscheidend ist, dass die USA und die EU sowie ihre Mitgliedstaaten eine grundsätzlich andere Auffassung von Kultur und der Rolle des Staates bei Erhalt und Förderung kultureller Vielfalt haben. Staaten wie Österreich und Deutschland verstehen sich explizit als Kulturstaaten, die durch ein ausdifferenziertes System an Kulturförderungen eine Vielfalt an Kultur ermöglichen wollen – eine Vielfalt, die auch jene Formen miteinschließt, die sich nicht alleine über den Markt und die Publikumsnachfrage finanzieren könnte. Ähnlich wie bei Gesundheit und Bildung wird Kultur ein Sonderstatus eingeräumt. Ihr Wert für die Gesellschaft lässt sich nicht auf den finanziell bezifferbaren Marktwert reduzieren. Demgegenüber wird Kultur in den USA als Handelsware wie viele andere angesehen. Der Staat soll möglichst wenig in den (Kultur-)Markt eingreifen.
Dieses unterschiedliche Verständnis von Kulturpolitik erklärt, warum Kulturschaffende die Verhandlungen der EU mit den USA – anders als bei den Verhandlungen mit Kanada, das eine der EU ähnliche kulturpolitische Tradition pflegt – besonders skeptisch verfolgen. Die Bedeutung des europäischen Marktes als aktuell bereits wichtigster Exportmarkt für die US-Unterhaltungsindustrie spielt ebenso eine Rolle.
8. Wie ist der Stand der Verhandlungen?
Acht von 15 geplanten Verhandlungsrunden sind abgeschlossen. Was bislang konkret vereinbart wurde, unterliegt der Geheimhaltung. Dies sei aus strategischen Gründen bei noch laufenden Verhandlungen notwendig, wie die Kommission stets betont. Lediglich ein ausgewählter Kreis an RegierungsvertreterInnen und EU-ParlamentarierInnen erhält Einblick in die Verhandlungsdokumente der EU, nicht jedoch in die Forderungspapiere der USA. Erst wenn sich die Verhandlungsteams der EU und der USA auf den finalen Text des Abkommens geeinigt haben und keine Änderungen mehr am Verhandlungsergebnis möglich sind, wird dieser veröffentlicht.
9. Was weiß man über die Verhandlungen im Kunst und Kulturbereich?
Nicht viel Gesichertes. In Folge der öffentlichen Mobilisierung gegen TTIP, nicht zuletzt wegen der rigiden Geheimhaltungspolitik und dem fehlenden öffentlichen Dialog über Ziele und Auswirkungen von TTIP, sah sich die Europäische Kommission veranlasst, eine „Transparenz- und Informationskampagne“ zu starten. Seitdem sind das Verhandlungsmandat und ein nicht-bindendes Positionspapier der Europäischen Kommission zu „TTIP und Kultur“ öffentlich zugänglich. Ob, was und wie über Kunst und Kultur tatsächlich verhandelt wird, ist nicht bekannt.
Das Mandat definiert lediglich das Verhandlungsziel, die kulturelle und sprachliche Vielfalt Europas durch TTIP nicht zu gefährden. Für audiovisuelle Dienste wurde ferner eine Teilausnahme verankert. Diese erstreckt sich auf das Kapitel über den Dienstleistungshandel, nicht jedoch auf andere TTIP-Kapitel wie Investitionsschutz und Regeln.
Ob und wie der Schutz der sprachlichen und kulturellen Vielfalt konkret in TTIP erreicht werden soll, liegt im Ermessen und Verhandlungsgeschick der Europäischen Kommission. Seitens des Kultursektors herrscht – zumindest im deutschsprachigen Raum – große Skepsis, dass die Kommission den Kunst- und Kulturbereich hinreichend absichert.
10. Was kritisiert der Kultursektor im Detail?
-
Negativ- statt Positivlisten
Bislang wurde in EU-Freihandelsabkommen in Positivlisten explizit aufgezählt, welche Bereiche liberalisiert werden. Bei TTIP hingegen soll der Negativlistenansatz zur Anwendung kommen. Bei diesem muss definiert werden, welche Bereiche nicht erfasst sind. Das heißt, was nicht explizit als Ausnahme in TTIP verankert wird, ist liberalisiert – nach dem Motto „list it or lose it“.
Jede einzelne Ausnahme für Kunst und Kultur muss damit gegenüber dem Verhandlungspartner gerechtfertigt werden. Wird ein Bereich schlichtweg vergessen, ist dieser automatisch von TTIP erfasst. Wird eine zukünftige Entwicklung nicht vorhergesehen und ausgenommen, ist auch diese erfasst. Eine nachträgliche Herausnahme einzelner Bereiche ist nicht möglich. Die Unmöglichkeit, alle technologischen Entwicklungen, alle zukünftig relevanten Produktions- und Verbreitungsarten vorherzusagen, liegt auf der Hand.
-
Schutzmechanismen ohne Bindungswirkung
Die Kommission will zum Schutz des Kunst- und Kulturbereichs einen Verweis auf die „UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ in der Präambel des TTIP-Abkommens verankern. Diese Konvention anerkennt explizit das Recht aller Staaten auf souveräne Ausgestaltung der Kulturpolitik. Ein derartiger Verweis im Vorspann des Abkommens entfaltet jedoch keine unmittelbare Schutzwirkung. Nur was explizit in den bindenden Bestimmungen des Abkommens verankert wird, etwa eine generelle Ausnahme für Kunst-, Kultur- und Medienpolitik, ist im Streitfall auch rechtlich durchsetzbar.
Unabhängig davon gehen ExpertInnen davon aus, dass die USA einen Verweis auf die UNESCO-Konvention nicht akzeptieren werden. Die USA sind der Konvention nicht beigetreten. Im Gegenteil: bis heute lehnen die USA die UNESCO-Konvention aufgrund ihrer handelspolitischen Implikationen ab.
-
Unklare Definition audiovisueller Dienstleistungen
Die Europäische Kommission darf nicht über den Handel mit audiovisuellen Dienstleistungen (Film, TV, Radio) verhandeln. Unklar ist jedoch, wie audiovisuelle Dienste – insbesondere im digitalen Umfeld – definiert werden. Angesichts der (Export)Stärke von US-Unternehmen im Bereich der Unterhaltungs- und Internetindustrie setzen sich die USA für eine möglichst enge Auslegung des Begriffs ein. Der digitale Bereich soll möglichst frei von staatlicher Regulierung bleiben, „neue“ audiovisuelle Dienste als reguläre Kommunikations-/Datendienste dem Telekommunikationsbereich zugeordnet werden. Kultur- und medienspezifische Regulierungen wären damit nicht mehr zulässig.
-
Keine Ausnahme für Kunst und Kultur
Anders als für audiovisuelle Dienstleistungen, ist die Europäische Kommission nicht verpflichtet, den Kunst- und Kulturbereich aus den Verhandlungen auszuklammern. Die Kommission argumentiert, dies sei weder möglich noch erforderlich. Das Handelsrecht kenne keine allgemein gültige Definition von Kultur. Was der Kultur zuzurechnen ist und was nicht, sei folglich eine Frage der Interpretation. Für eine Ausnahme von Sektoren mit „starken kulturellen Komponenten“ – konkret Bibliotheken, Archive und Museen – wolle sich die Kommission aber einsetzten.
In anderen Bereichen wie Literatur und Verlagswesen, Orchester und Theater, sei dies nicht erforderlich. Ihr Schutz sei durch die angestrebte Ausnahme für Subventionen abgesichert. Abgesehen von staatlichen Beihilfen stehen damit alle anderen kulturpolitischen Maßnahmen zur Diskussion – sofern sie nationales Kulturschaffen begünstigen und damit „wettbewerbsverzerrend“ wirken.
-
Fehlende Rechtssicherheit für Vielfaltsförderung
Bereichsausnahmen für audiovisuelle und kulturelle Dienstleistungen alleine – sofern sie verankert werden – sind nicht ausreichend. Auch Regulierungen in anderen Bereichen können der Vielfaltsförderung dienen, etwa im Bereich von Versicherungsdienstleistungen (z.B. Künstlersozialversicherung) oder der Telekommunikation (z.B. „must-carry“ Regelungen, die Kabelnetzbetreiber verpflichten, auch lokale und öffentlich-rechtliche Sender zu übertragen). Zur Sicherung kulturpolitischer Maßnahmen, die auf Schutz und Förderung der Kultur- und Medienvielfalt abzielen, wird daher vielfach eine Generalausnahme aus dem TTIP-Geltungsbereich gefordert.
-
Auswirkungen des Investitionsschutzes…
TTIP soll sogenannte Investitionsschutzklauseln enthalten. Diese sollen sicherstellen, dass ausländische Investoren/Unternehmen wie inländische behandelt werden und ihre Investitionen z.B. vor Enteignung geschützt sind. Verbunden damit ist das Recht des Investors, den Staat zu verklagen, wenn seine Geschäftstätigkeit/Gewinnerwartung durch politische Entscheidungen beeinträchtigt wird. Verhandelt werden derartige Streitfälle vor internationalen Schiedsgerichten. Deren Entscheidungen sind endgültig, bindend und zu vollstrecken.
Die TTIP-Investitionsschutzklauseln sollen auch für den Medien- und Kulturbereich gelten, inklusive audiovisueller Dienste. Denn die audiovisuelle Ausnahme erstreckt sich lediglich auf das Kapitel über den Dienstleistungshandel, nicht auf andere TTIP-Kapitel wie Investitionsschutz und Regeln. Die kultur-und demokratiepolitischen Implikationen sind offensichtlich: Welche Rolle kommt demokratisch legitimierten Gesetzgebern gegenüber einer privaten Schiedsgerichtbarkeit zu?
-
... und von Regelungen
Auch das Ziel von mehr regulatorischer Kompatibilität zwischen der EU und den USA ist für den Kulturbereich relevant. Vorgesehen ist unter anderem ein Kapitel zu Regeln des Geistigen Eigentums und zu E-Commerce.
Nicht nur im Bereich der Kulturpolitik, auch in Fragen des Geistigen Eigentums pflegen die USA und die EU unterschiedliche Traditionen. Während in der europäischen Tradition die UrheberInnen und ihre moralischen sowie ökonomischen Rechte im Mittelpunkt stehen, stellt die US-Tradition auf den Schutz der Rechte der ProduzentInnen und deren Verwertungsrechte ab. Eine Verständigung auf gemeinsame Regeln könnte die europäischen Schutzstandards aushöhlen.
Besonderen Wert legen die USA ferner auf E-Commerce-Regeln. Für den Handel mit digitalen Produkten sollen möglichst alle Einschränkungen der Handelsliberalisierung vermieden werden. Dabei ist es irrelevant, ob es sich um den Online-Handel physischer Güter (wie Bücher oder CDs) oder um elektronisch übermittelte Produkte (durch Download oder Streaming) handelt. Es steht zu befürchten, dass sich die USA Ausnahmen zum Schutz der Kulturförderung im Tausch gegen weitreichende Zugeständnisse im Bereich E-Commerce abgelten lassen.
11. Was passiert nach den Verhandlungen?
Nach Abschluss der Verhandlungen wird der TTIP-Vertragstext dem Europäischen Rat, also den Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Mitgliedstaaten, und dem Europäischen Parlament zur Abstimmung vorgelegt. Diese können den Vertragstext entweder als Ganzes annehmen oder ablehnen. Änderungen nach Verhandlungsabschluss sind nicht möglich.
Ob TTIP als sogenanntes „gemischtes Abkommen“ einzustufen ist oder nicht, wird erst nach Verhandlungsabschluss feststehen. Handelt es sich um ein „gemischtes Abkommen“ bedarf TTIP zusätzlich der Zustimmung der 28 nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten. Bis diese jedoch TTIP zugestimmt haben, wird das Abkommen vorläufig angewendet.
12. Fazit: Gefährdet TTIP Österreichs Kunst und Kultur?
Dies ist ein großes Fragezeichen und wird letztlich erst zu beantworten sein, wenn der fertig ausverhandelte TTIP-Vertragstext veröffentlicht wird. Denn natürlich kann sich die Europäische Kommission dafür einsetzen, den Kultur – und Medienbereich bzw. kultur- und medienpolitische Maßnahmen aus dem Geltungsbereich des Abkommens auszuklammern. Verpflichtet ist sie dazu nicht. Dass sie dies anstrebt, ist zu bezweifeln. Und ob die Kommission eine allgemeine Kulturausnahme gegenüber den USA durchsetzen kann, ist eine weitere Frage.
Auf dem Spiel steht jedenfalls nicht nur die Wahrung des Status Quo, sondern auch der zukünftige (kultur-)politische Handlungsspielraum zu Schutz und Förderung der kulturellen Vielfalt.
Links